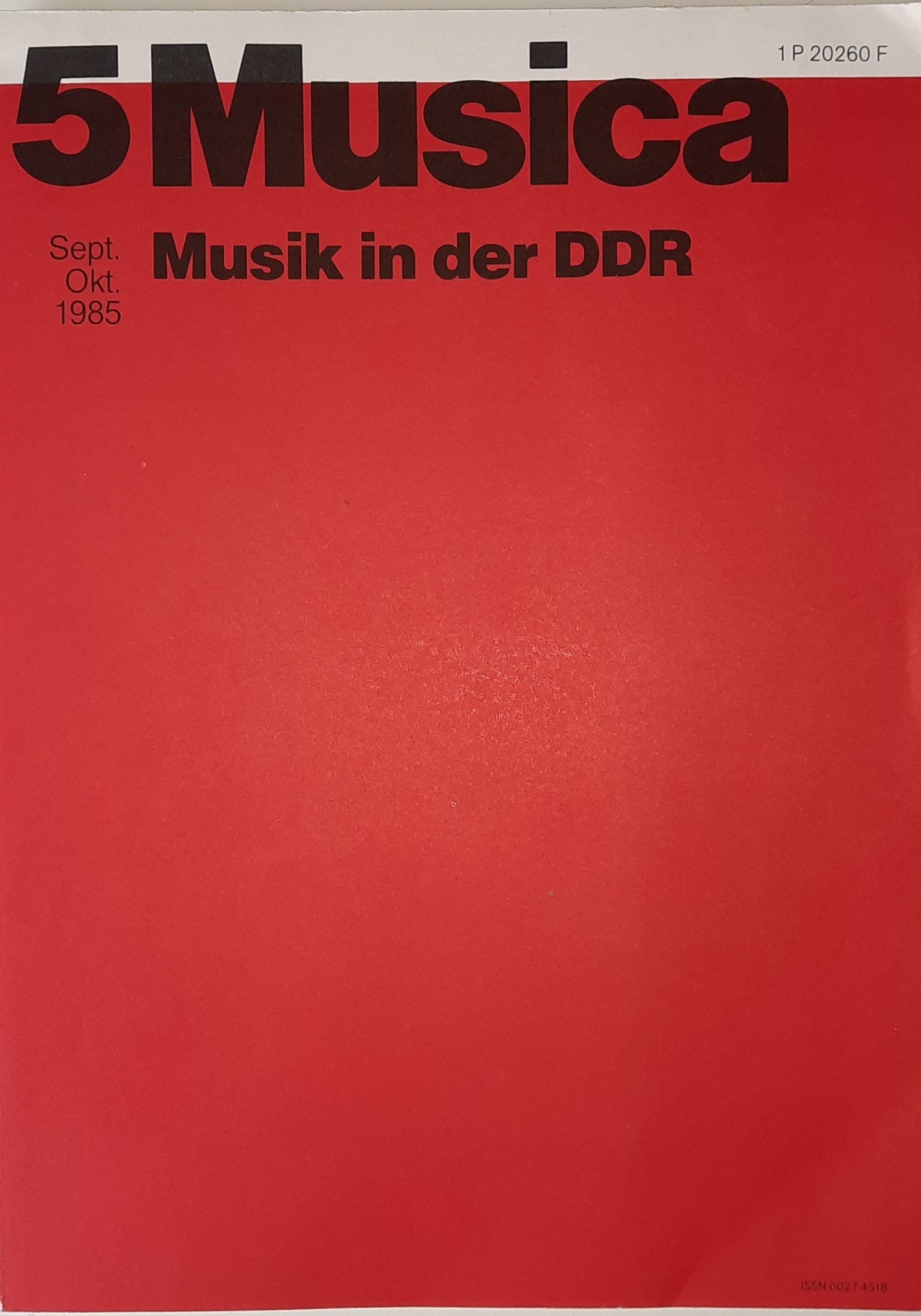Singen-Reihe: Neues und Altes aus dem Silcher-Museum
Rainer Herberger (1939–2013) war ein deutscher Musikpädagoge aus Leipzig. Nach seiner Tätigkeit als Lehrer fungierte er als Dozent für Musikerziehung an der Musikhochschule in Leipzig. Dabei blieb sein Wirken nicht auf die ehemalige DDR beschränkt. Nach der Wiedervereinigung war er Leiter der Sektion Schulmusik an der Musikhochschule Leipzig und u.a. Teil des Arbeitskreises für musikpädagogische Forschung. In seinem Aufsatz „Musikerziehung in der DDR“ beschreibt er die Inhalte des Musikunterrichts an den Schulen der DDR und gibt Einblicke in weitere Bildungswege.
Die musisch-ästhetische Erziehung, so Herberger, sei in der DDR fest integriert „in das System der sozialistischen Allgemeinbildung“, die einen entscheidenden Teil zur Persönlichkeitsentwicklung beitrage. Diese beginne bereits im Vorschulalter. In den Kindergärten lernten die Kinder das Singen, rhythmische Bewegung und das Musizieren auf klingendem Schlagwerk. Anhand der erwähnten Literatur wie „Alle meine Entchen“ oder „Schlaf, Kindchen schlaf“ lasse sich allerdings noch keine sozialistische Gesinnung erkennen.
Dies ändere sich jedoch mit dem Eintritt in die Schule, wo die „spielerische und gestische Gestaltung […], körperliche Bewegungen […] und Lieder der Jungpioniere“ auf dem Stundenplan zu finden sind. Dabei solle die gehörte Literatur in einem „ausgewogenen Verhältnis“ zu Werken von Bach, Mozart, Schubert oder Schumann stehen. Im Vordergrund stehe die Erziehung zur Musik, heißt Unterscheidung von Dur und Moll, rhythmisch-metrische Zusammenhänge und die Grundlagen des Notensystems. In der Mittelstufe werden diese Kenntnisse gefestigt und erweitert. „In das Liedrepertoire“, so Herberger, „werden weitere Volkslieder, Lieder der Arbeiterbewegung [und] Lieder der Thälmannpioniere“ aufgenommen, wobei vermehrt zwei- und dreistimmiges Singen genutzt wird. Dabei solle bei der Aneignung der Musik besonders auf die gesellschaftliche „Bedeutung und Bezogenheit in Vergangenheit und Gegenwart“ geachtet werden.
Vermittlung im Sinne des sozialistischen Weltbildes
Übersetzt heißt das: Vermittlung und Festigung des sozialistischen Weltbildes in der Schule. Dies lässt sich neben den erwähnten Liedern der Pioniere und Arbeiterbewegung auch an den von Herberger genannten Themen des Unterrichts festmachen: „Die Pflege des kulturellen Erbes als Anliegen sozialistischer Kulturpolitik“ oder auch „Grundfragen der Kulturpolitik unseres sozialistischen Staates“.
In der Oberstufe könne dies noch weiter vertieft werden. Hervorzuheben ist, dass auf dem Lehrplan vorwiegend osteuropäische bzw. sowjetische Künstler vertieft werden. An vielen Schulen und Pionierhäusern existierten Chöre, Sing- und Instrumentalgruppen und musikalische Arbeitsgruppen. Die Musikschulen sieht Herberger als „die wichtigsten Institutionen der spezialisierten instrumentalen und vokalen Musikerziehung“. Diese stünden in engem Austausch mit Kindergärten und Schulen. Eine besondere sozialistische Erziehung lässt sich aus Herbergers Äußerungen diesbezüglich nicht entnehmen, ist aber zu vermuten.
Musikerziehung systematisch und großzügig gefördert
Herberger kommt in seinem Aufsatz zu der Schlussfolgerung, dass die Musikerziehung in der DDR „sehr ernsthaft, systematisch und mit großzügiger staatlicher Förderung realisiert wird“, sodass jedem Menschen in der DDR „die Möglichkeit gegeben ist, seine musikalischen Fähigkeiten optimal zu entwickeln“, um das kulturelle Leben aktiv mitzugestalten. Wichtig hervorzuheben ist hierbei, dass die Musikerziehung in Teilen auf der sozialistischen Propaganda fußte, die zum Ziel hatte, die Kinder ideologisch zu erziehen. Dies sollte bei einer solchen Einordnung immer mitbedacht werden.
Anzeige