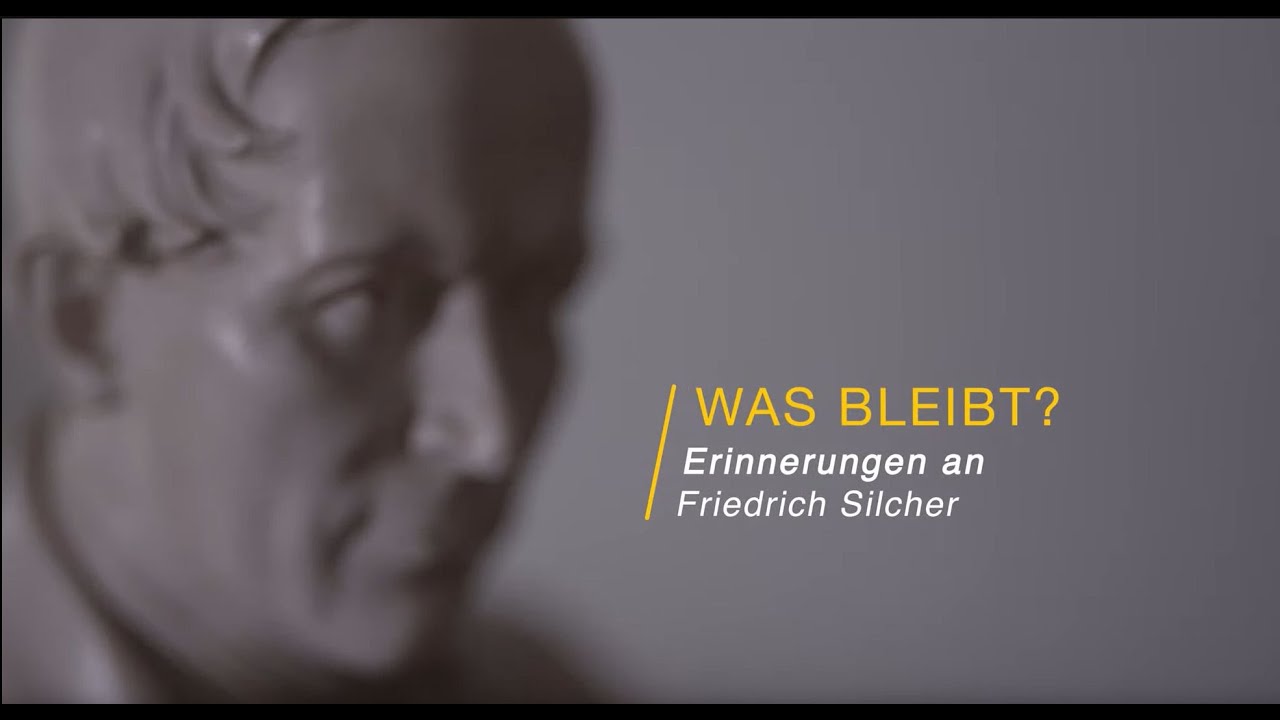Friedrich Silcher – ein Unbekannter?
Im kulturellen Gedächtnis der Deutschen hat Friedrich Silcher sicher nicht den Stellenwert, den er verdient. Andere große Persönlichkeiten seiner Zeit, wie beispielsweise Friedrich Schiller, sind heute der Grund, warum Deutschland als „Land der Dichter und Denker“ gilt. Silcher hingegen ist ein „bekannter Unbekannter“. Dabei ist der schwäbische Reformpädagoge und Volksliedsammler jener Komponist, der Lieder internationaler Bekanntheit schrieb, wie etwa „Ännchen von Tharau“, „Am Brunnen vor dem Tore“ oder die „Loreley“. Talent und Persönlichkeit waren dabei maßgebend für Silchers Karriere, seine vielen Unterstützer in höheren Kreisen und auch entscheidend für seine spätere Stelle als erster Universitätsmusikdirektor in Tübingen. Hier sorgte er für die Wiederbelebung der Chormusik in Gottesdiensten. Zudem gründete er den Oratorienverein und die Liedertafel Tübingen, die er bis zu seinem Tod 1860 leitete. Was bleibt von alldem 200 Jahre danach? Eine Spurensuche.
Das Komponisten- und Heimatmuseum
Im Silcher-Museum war am Anfang insbesondere der Bezug zur Person Silcher wichtig: Verehrungsstücke wurden gesammelt. Außerdem galt das Museum über Jahrzehnte hinweg auch als Heimatmuseum. Dass ein Museum von einem Verband wie dem SCV so lange getragen wurde, sei etwas ganz Besonderes, sagt die ehemalige Leiterin Elisabeth Hardtke. Außerdem sei es eines der ältesten Komponisten-Museen Deutschlands, in einer Reihe mit dem Beethoven-Haus Bonn oder dem Wagner-Museum Bayreuth. Dass das Silcher-Museum geschlossen wurde, sei aber auch den Ansprüchen der Zeit geschuldet, da manche Stücke nicht mehr „erhaltenswert“ gewesen seien. Das Museum hat viele Jahre lang Vermittlungsarbeit über Silchers Leben, sein Werk und seine Zeit geleistet: eine Zeit des Umbruchs. Zwischen den rationalen Ideen der Aufklärung und den radikalen Ideen der französischen Revolution suchten viele Menschen einen Ausweg. Sie fanden Zuflucht in der Seele der deutschen Romantik, die mehr dem Innern, mehr dem Menschen zugewandt schien.
Zeiten des Umbruchs
Die Bestände des Museums wurden abgegeben. Ein Teil hat der SCV an das Deutsche Literaturarchiv in Marbach verschenkt. Dort werde vor allem das Singen als Politikum deutlich, betont die Leiterin des DLA, Dr. Gunilla Eschenbach, denn Silcher hätte, aufgrund der Aufführung verbotener Werke und daher aufgrund seines Widerstands gegen die Obrigkeit, auch im Gefängnis enden können. Andere Bestandteile des Museums, wie Silchers Klavier, sind nun Teil der Firmenausstellung der Wendlinger Instrumentenbaufirma Schiedmayer. Andere Teile wurden dem Stadtmuseum Tübingen übergeben.
Was bleibt?
Die Kirchen-, Jugend- und Hausmusik ist durch Silcher enorm geprägt worden. Der traurige Höhepunkt: die Vereinnahmung des Singens als Propaganda im Nationalsozialismus, die dazu führte, dass Theodor W. Adorno das Singen im Chor als „dubios“ abtat. Und dennoch ist das Singen heute gleichbedeutend als Volksbildung, unabhängig von Stand und Beruf. Das demokratische Verständnis dabei: Jede:r bringe das ein, was er bzw. sie gut könne. So definiert es Matthias Klosinski, künstlerischer Leiter des Ensembles Cantus X. Das Singen galt schon zu Zeiten Silchers als Hort der sozialen Gleichheit aller Sänger.
Für die Vermittlung all dieser Themen waren jahrelang die Kustod:innen des Silcher-Museums entscheidend. Dabei sei es wichtig, auch wenn Silcher „toll“ gewesen sei, das Ganze „ohne rosarote Brille“ zu tun, findet Elisabeth Hardtke. Silchers Geburtshaus bleibt eine Erinnerungsstätte, nun eben ohne Bildungsauftrag. Teile der Ausstellung können an anderen Ausstellungsorten begutachtet werden und zeigen teilweise neue Perspektiven. Was bleibt, sind sein Werk und Vermächtnis – die Lieder, die weltweit Verbreitung erreicht haben.
Die Dokumentation des Schwäbischen Chor-verbands über das Silcher-Museum mit dem Titel „Was bleibt?“ ist auf YouTube zu finden.