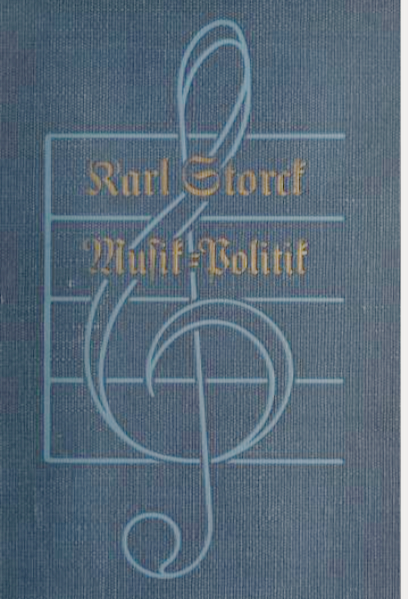Auszüge der Beiträge zur „Musik-Politik“ (1911) von Dr. Karl Storck
Karl Storck (1873–1920) war nach eigener Definition „Kulturschriftsteller, Kritiker oder Redakteur“. Er selbst sah sich als musikpädagogischer Außenseiter, obwohl er in Straßburg und Berlin neben Germanistik und Philosophie auch Musik studiert hatte. Er war im Hauptberuf seit 1898 bei der Zeitschrift „Der Türmer“ als Redakteur tätig. Diese nationalkonservative, protestantische Kulturzeitschrift war qua eigener Definition „Monatsschrift für Gemüt und Geist“ mit dem kulturpolitischen Auftrag einer Erneuerung des „Deutschtums“ und entwickelte sich zu einem der wichtigsten Kulturmedien des Wilhelminismus. Hier war er schon bald für den Kunstteil verantwortlich. Auch für andere Zeitschriften schrieb er viel im Musikteil und verfasste eigene Werke.
Die Gartenkonzerte kritisiert er hinsichtlich ihrer Programmgestaltung: Diese „Potpourris, Märsche, Tänze, Pistonsolos und Ouvertüren“ seien wild durcheinandergemischt. Eine ganze Sinfonie wäre ihm lieber. Ebenso fehlen ihm in den Gartenkonzerten die Solisten. Dieser „volkstümliche Charakter“, den die Gartenkonzerte tragen müssten, sei besser abgedeckt durch Musik, die auch für das Musizieren im Freien geeignet wäre, anders als es jetzt sei. Hierfür eigne sich besonders Musik von Beethoven, Kammermusik für Bläserensembles, Musik für kleinere Orchester und ältere Chormusik wie Madrigale, so Storck.
Gassenmusik
Mit Gassenmusik meint er Musik an öffentlichen Orten. Davon wünscht er sich wieder mehr. Es genüge dabei nicht, nur die Musik „zu den Leuten hinzubringen“, sondern es sei entscheidend „wie das Verhältnis zur Kunst“ sei. Daher sei es auch so leicht, von der Kirche aus künstlerisch zu wirken. Dies, so Storck, sei das Erfolgsgeheimnis der (Männer-)Gesangsvereine, die Ausdruck des nationalen Sehnens des 19. Jahrhunderts gewesen seien. Diese Volksmusik müsse den Menschen wieder nahegebracht werden, um die musikalische Volkskultur wieder zu beleben. Dabei müssten alle sozialen Schichten miteinbezogen werden. Alle Musikschaffenden aus den Kapellen, städtischen Orchestern und Gesangsvereinen (und dabei meint er explizit nicht nur Männerchöre) und den Schulen, sollten gemeinsam an einem öffentlichen Platz Musik machen. Von Seiten der Gemeinde müsse dies unterstützt werden. Das Volk sei „durch und durch musikalisch“ und müsse mehr musizieren.
Konzerte an kleinen Orten
Viel Musikpflege in großen Städten, wenig Musikpflege in kleinen Orten – das öffentliche Musikleben sei Ausdruck einer „Dezentralisation“. Dass große Orchester oder bekannte Persönlichkeiten nicht an jene Orte kämen, weil es finanziell nicht rentabel sei, das sieht Storck ein. Dass die Zahl an Zuhörenden aber nicht aufzubringen sei, wohl kaum. Die „Hausmusik“ erfahre hierdurch „Befruchtung und Belebung“. Hierfür sei die Mitarbeit der Musikschaffenden vor Ort essenziell, die sich um alles Organisatorische kümmern müssten. Als Künstler müssten nicht die Berliner Philharmoniker engagiert werden, aber man könne ein Programm an die Kammermusik-Vereinigung schicken und dort nach entsprechenden Künstlerinnen und Künstlern anfragen. Als Auftrittssaal genüge schon ein Wirtshaus oder ein Schulraum. Kammermusik käme für solche Örtlichkeiten ideal in Frage. Weg vom Konzertsaal, hin zu Hausmusik. Sein Schlussplädoyer lautet: „Sorgt für gute Konzerte an kleinen Orten. Sie sind das beste Mittel zur Pflege einer guten Hausmusik, also zu einer gesunden Musikpflege überhaupt!“
Anzeige