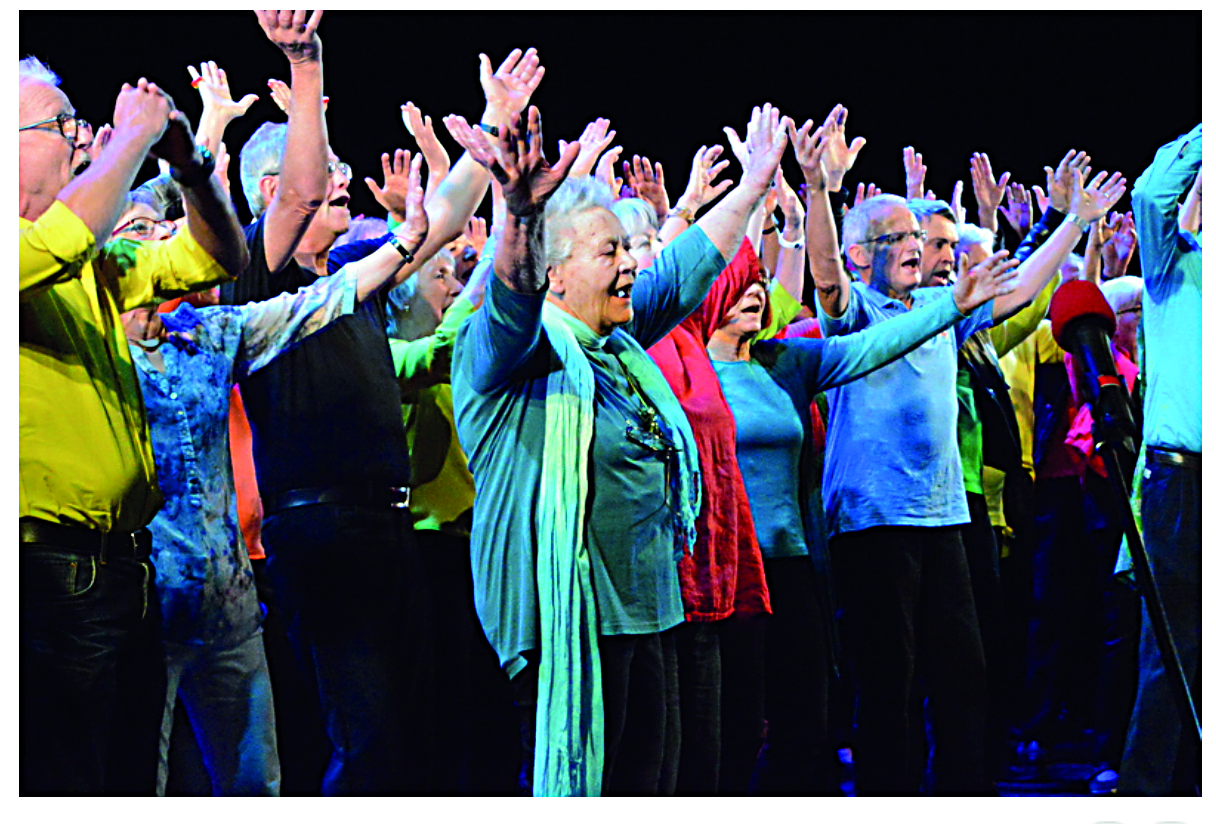Wie ein Chor sein muss, damit das Selbstvertrauen seiner Mitglieder und der Chor als Ganzes gestärkt wird – Tipps aus Wissenschaft und Praxis.
Liebe Leserinnen und Leser der Zeitschrift SINGEN, denken Sie mal an eine beliebige berufliche oder private Herausforderung, die Sie gemeistert haben! Selbstvertrauen wird dabei eine bedeutende Rolle gespielt haben. Es gibt wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, wie man Selbstvertrauen stärken kann. Das sollten wir in unseren Chören nutzen. Dazu soll dieser Artikel einen Beitrag leisten.
Auswirkungen von Selbstvertrauen
Ich beschäftige mich wissenschaftlich und praktisch mit der Frage, wie man Selbstvertrauen fördern kann, weil ich es als Chorleiter und Musikpädagoge oft erlebe, dass sich Menschen mit hohem Selbstvertrauen bei gleichen Fähigkeiten besser entwickeln als Menschen, die aufgrund von niedrigem Selbstvertrauen schneller aufgeben oder es gar nicht erst probieren.
Im Extremfall kann niedriges Selbstvertrauen sogar zu einem Teufelskreis werden aus Resignation, Teilnahmslosigkeit, Depression und selbsterfüllenden Prophezeiungen („Das hat eh alles keinen Sinn, ich kann eh nichts bewirken“). Das andere Extrem – Menschen mit krankhaften Selbstüberschätzungen, die völlig selbstverliebt durch die Welt stolzieren – ist auch unschön.
Schön ist ein gesundes Maß an Selbstvertrauen. Das ist nämlich die Basis dafür, dass Menschen offen, mutig, widerstandsfähig, ausdauernd, kreativ, selbstbestimmt und glücklich ihr Leben gestalten, Beziehungen pflegen, Ziele verfolgen und Potentiale entfalten. Stellen Sie sich mal vor, alle Menschen in Ihrem Chor wären so! Da würde einiges gehen, behaupte ich mal.
Fachwort für Selbstvertrauen: Selbstwirksamkeit
Ok, jetzt kommt ein wissenschaftlicher Teil und wir müssen durch ein paar Fachbegriffe durch – aber es lohnt sich! Also, es gibt in der Psychologie und Pädagogik ein tolles Fachwort namens Selbstwirksamkeit beziehungsweise Selbstwirksamkeitserwartungen. Zugegeben: das ist ein langes Wort. Im Deutschen stecken ja manchmal in einem Wort gleich mehrere Wörter. In diesem Fachwort steckt – relativ knackig! – sogar der ganze folgende Absatz.
Selbstvertrauen hat etwas mit Einschätzungen und Erwartungen zu tun: Eine Herausforderung kommt auf mich zu und ich schätze ein (häufig unbewusst und blitzschnell), ob ich sie selbst meistern kann. Ich habe dabei ein Gefühl dafür, wie wirksam meine Möglichkeiten und Fähigkeiten für das Meistern dieser Herausforderung sind. Mit diesem Gefühl kann ich mich komplett irren (siehe oben), aber es bestimmt meine Erwartungen: Wenn ich erwarte, dass meine Möglichkeiten und Fähigkeiten sehr wirksam sind, dann spricht man von hohen Selbstwirksamkeitserwartungen umgekehrt von niedrigen.
Wie entstehen Selbstwirksamkeitserwartungen?
Das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartungen wurde von dem Psychologen Albert Bandura in den 1970er Jahren entwickelt und seitdem weltweit von Forschungsteams in Experimenten und Studien untersucht und belegt. Dabei zeigte sich, dass folgende
vier Quellen mit absteigendem Einfluss die Grundlage von Selbstwirksamkeitserwartungen bilden:
1. persönliche Erfolgserfahrungen
2. stellvertretende Erfolgserfahrungen
3. sprachliche Überzeugungen
4. physiologische und emotionale Zustände
Persönliche Erfolgserfahrungen
Persönliche Erfolgserfahrungen bei ähnlichen Herausforderungen haben den mit Abstand größten Einfluss auf Selbstwirksamkeitserwartungen („Hab ich schon oft gemacht, kriege ich hin!“).
Damit aus großen Herausforderungen („Wir singen die Matthäus-Passion!“) Erfolgserfahrungen werden, sollten diese in übersichtliche und motivierende Nahziele aufgeteilt werden („Nächste Woche proben wir die Nummern 3, 10, 62 und 68!“), die man mit Hilfsmitteln und Engagement erreichen kann („Übe-Aufnahmen für jede Stimmgruppe gibt’s hier!“) und mit einer gewissen Fehlertoleranz als erreichte Zwischenziele auch feiern sollte („Ok, wir lassen das jetzt dann so. Prost auf die Nr. 62!“). Das ermöglicht die unerlässliche Erfahrung vieler kleiner Erfolge.
Individuelle Auswahlmöglichkeiten und Beurteilungen können ebenfalls Erfolgserfahrungen begünstigen, gerade wenn die Chormitglieder sehr unterschiedliche Anspruchsniveaus haben („Völlig normal, wenn die Fugen noch zu schwierig sind. Du machst eine tolle Entwicklung, aber das ist noch neu für dich und braucht einfach einige Jahre Erfahrung. Du kannst trotzdem gerne mitproben und es mit der Stimmbildnerin und den Übe-Dateien versuchen. Und/oder: Du kannst auch beim Konzert ausschließlich die Choräle mitsingen, das machen einige im Chor.“).
Chormitglieder erleben Proben und Konzerte viel mehr als persönliche Erfolgserfahrungen, wenn sie bei diesen nicht „nur“ gesagt bekommen, was sie tun sollen, sondern sie mit ihren Talenten, Ideen und Wünschen aktiv mitgestalten (können).
Stellvertretende Erfolgserfahrungen
Erfolgserfahrungen kann man auch stellvertretend durch Beobachtung machen („Wenn der/die das hinbekommt, kann/will ich das auch!“). Das klappt auch dann besonders gut, wenn sich die beobachtete und die nachahmende Person möglichst ähnlich und/oder sympathisch sind. Wenn z.B. im Kinder- oder Jugendchor der Altersunterschied zwischen Chormitglied und Chorleitung hoch ist, kann es besonders sinnvoll sein, dass andere Kinder oder Jugendliche als Multiplikatoren wirken.
In einem musikpädagogischen Forschungsprojekt an einer Kölner Brennpunktschule haben meine Kolleginnen und ich zum Beispiel gesangsbegeisterten Jugendlichen, die sich keinen Gesangsunterricht leisten konnten, eine „Gesangspaten-Ausbildung“ angeboten: „Du bekommst schulfrei an den Ausbildungstagen und eine Urkunde am Ende. Die Kosten übernehmen wir für dich, weil wir dich toll finden. Einzige Bedingung: Die Lieder, Spiele und Bodypercussion-Grooves, die Du lernst, zeigst Du auch anderen Jugendlichen.“
Lehrkräfte „buchen“ die Gesangspaten mittlerweile als „Spezialeinheit“ für sogenannte „vocal breaks“: So kommt zum Beispiel mitten im Erdkunde-Unterricht diese „Spezialeinheit“ ins Klassenzimmer und singt und musiziert für ein paar Minuten gemeinsam mit der Klasse. Diese „musikalischen Pausen“ sind sehr beliebt. Bei den Lehrkräften und den Jugendlichen.
Dadurch entsteht ein Multiplikatoreneffekt: Die Gesangspaten werden auch privat von Freunden um Tipps gebeten („Wie machst Du das?“) und durch das Vormachen und Erklären üben sie wiederum selbst.
Sicherlich können sich auch in Ihrem Chor Mitglieder untereinander helfen und fördern und für stellvertretende und persönliche Erfolgserfahrungen sorgen!?
Sprachliche Überzeugungen
Damit sind Rückmeldungen im weitesten Sinne gemeint. Wenn Chormitglieder ausgelacht, verängstigt oder gedemütigt werden, ist dies selbstwirksamkeitsschädlich. Positiv auf Leistung und Selbstwirksamkeit wirkt eher Freundlichkeit und die Einschätzung, dass einem Menschen mehr zuzutrauen ist, als er derzeit kann. Diese pädagogische Voreingenommenheit wirkt in allen Altersstufen und wird in Wissenschaft auch als Erwartungseffekt oder Pygmalion-Effekt beschrieben.
Rückmeldungen sind dann besonders selbstwirksamkeitsförderlich, wenn sie sich auf Ursachen beziehen, welche die gelobte Person auch selbst beeinflussen kann. „Bei deinen rhythmischen Fähigkeiten merkt man die jahrelange Erfahrung und Übung!“ ist selbstwirksamkeitsförderlicher und motivierender als „Ja, den Rhythmus im Blut hast Du von deinem Vater geerbt!“.
Wenn die Chormitglieder also genau wissen, was ihr nächstes Nahziel ist (siehe oben) und wie sie es durch Anstrengung und mit Hilfe vermittelter Bewältigungsmöglichkeiten erreichen können, dann ist ein Feedback, das direkt auf diese Zielerreichung folgt und sich dabei sowohl auf beeinflussbare Ursachen als auch den individuellen Fortschritt der jeweiligen Person bezieht, sehr selbstwirksamkeitsförderlich. Je häufiger auf diese Weise das Erreichen von Nahzielen gelobt wird, desto stärker ist der Effekt. In der Amateurmusik können auch Leistungsabzeichen einen solchen individuellen Fortschritt durch Anstrengung sichtbar machen und als eine Form von Anerkennung und Wertschätzung interpretiert werden, vor allem wenn sie als Auszeichnung feierlich übergeben werden. Wertschätzung durch die anderen Chormitglieder kann dabei einen verstärkenden Effekt haben.
Physiologische und emotionale Zustände
Wenn sich ein Mensch wach/müde, gut/schlecht gelaunt und gesund/krank fühlt, dann sind seine Selbstwirksamkeitserwartungen und seine Motivation grundsätzlich höher/niedriger. Psyche beeinflusst Körpersprache, aber auch andersherum: Durch bewusstes, absichtliches Lächeln oder eine aufrechte Körperhaltung lässt sich die Stimmung verbessern. Dieses Phänomen wird Embodiment genannt. Diesen Embodiment-
Effekt habe ich sehr deutlich in einem meiner Kinderchor von mir erlebt.
Der Kinderchor probte in einer Grundschule nach der eigentlichen Schulzeit. Viele der Kinder schlurften zu diesem Zeitpunkt müde
in den Musikraum. Das Einsingen startete immer zunächst mit Räkeln und Strecken. Darauf folgte eine aktivierende Übung:
Wenn ich am Klavier spielte, rannten alle Kinder herum. Wenn ich pausierte, blieben sie stehen. Danach folgte auf Wunsch der Kinder immer das „Zitrone-Cabrio-Spiel“: Beim Signalwort „Zitrone“ stellten sich alle vor, dass sie in eine Zitrone beißen und sich die gesamte Gesichtsmuskulatur zusammen zog. Beim Signalwort „Cabrio“ stellten sich die Kinder vor, dass sie in einem Cabrio mit 200 km/h über die Autobahn düsen und ihnen der Fahrtwind so ins Gesicht bläst, dass die Augen und der Mund ganz weit aufgerissen werden. Machen Sie das mal. Jetzt. Und dann wechseln Sie immer schneller werdend zwischen „Zitrone“ und „Cabrio“. Ab einem gewissen Tempo bekamen immer einige der Kinder einen Lachkrampf.
Grundsätzlich bieten sich hierfür alle Methoden und Musiken an, welche einen positiven Effekt auf die Stimmung und Körpersprache der Chormitglieder haben.
Fazit
Ein großes Thema für einen kleinen Artikel. Bei Interesse an verwendeter und weiterführender Literatur oder Vorträgen, Workshops und Austausch zu diesem Thema, können Sie mir gerne schreiben. Besonders freut mich, wenn Sie durch diesen Artikel (eigene) Ideen für Ihren Chor mitnehmen und mit hohen Selbstwirksamkeitserwartungen einfach mal ausprobieren. Gemäß dem Motto von Pippi Langstrumpf: „Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut.“
Anzeige