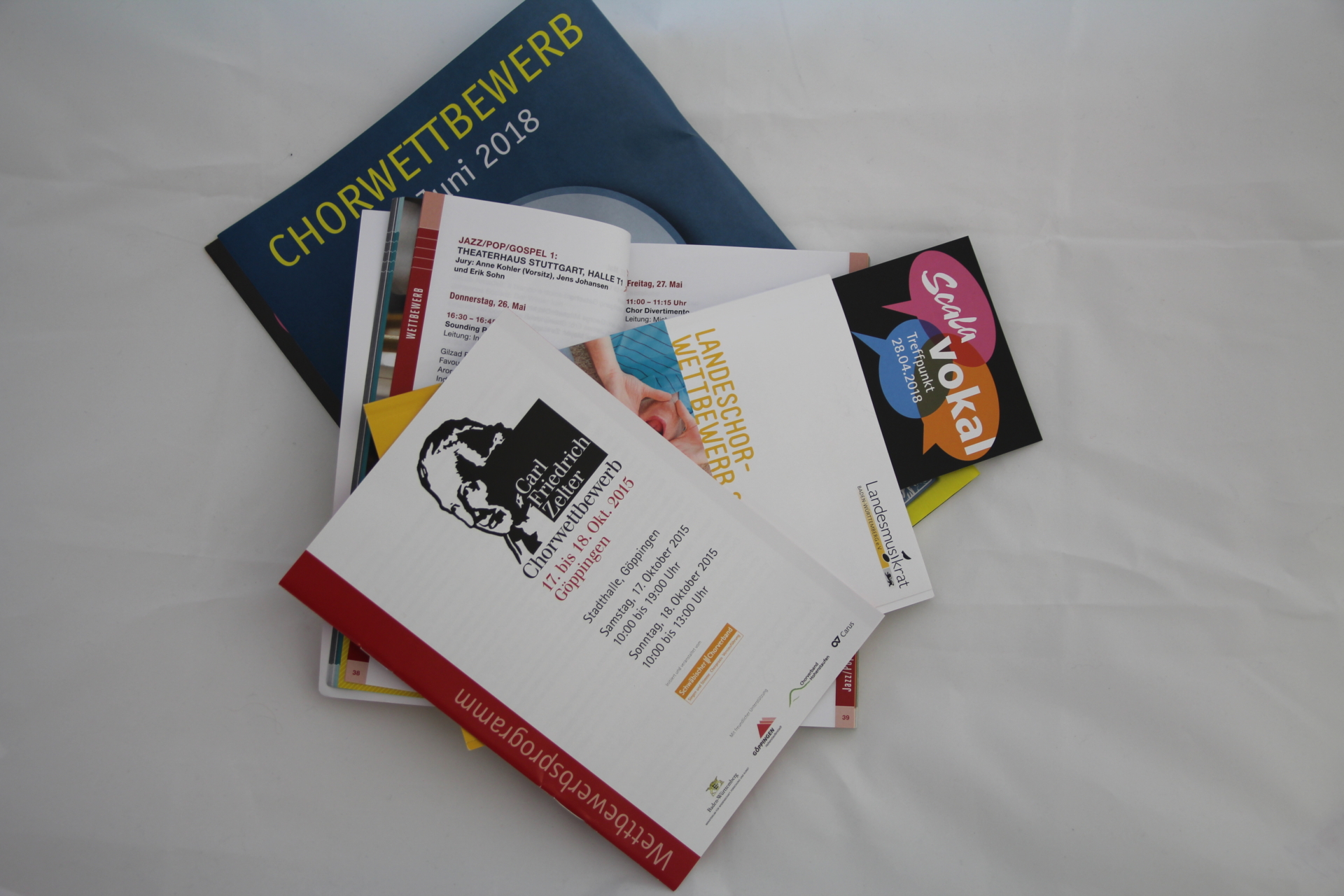Jörg Thum ist professioneller Chorleiter und nimmt mit seinen Chören – überwiegend aus dem Amateurbereich – regelmäßig an Wettbewerben teil. Wir sprachen mit ihm über die intensive Vorbereitung, die Emotionen dabei und was die Teilnahme an einem Wettbewerb mit einem Chor macht.
SINGEN: Herr Thum, was reizt Sie persönlich denn an Wettbewerben?
Jörg Thum (JT): Das muss man aus zwei Perspektiven betrachten: Zum einen finde ich es total spannend, dass man auf ein Ziel gerichtet alle Kräfte bündelt und letztendlich auch einen Chor damit total gut motivieren kann, wenn man sagt: „Wir haben zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Wettbewerb und bis dahin wollen wir die Stücke bestmöglich einstudieren und präsentieren.“ So etwas stärkt meiner Mei-nung nach einen Chor ungemein, zum einen musikalisch, zum anderen aber auch bezüglich der Gemeinschaft. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Power es in einen Chor bringt, wenn alle an einem Strang ziehen und das gleiche Ziel verfolgen.
Zum anderen finde ich es total wertvoll, wenn die eigene Arbeit oder die des Chores von außen betrachtet und bewertet wird. Vor allem die Jury-Gespräche mit dem Dirigenten, in denen man dann auch wirklich ins Detail geht, finde ich persönlich sehr wertvoll. Von außen betrachtet sieht man das eine oder andere einfach anders und so eine konstruktive Kritik ist sicherlich befruchtend und wertvoll.
SINGEN: Wie sieht denn bei Ihnen die Vorbereitung auf einen Wettbewerb mit einem Chor aus?
JT: Das ist oft dem Genre geschuldet. Wenn irgendwann der Wunsch oder der Gedanke da ist, zu einem Wettbewerb zu gehen, dann wird erst einmal geschaut, was die Richtlinien bzw. Voraussetzungen sind. Welche Epochen kann man auswählen? Wird a cappella verlangt? Und dann sucht man Stücke aus, die den Chor schon auch an sein Limit bringen.
Die Kunst besteht darin, den Chor ans Limit zu führen, aber nicht darüber hinaus. Ich glaube, das ist nicht immer ganz einfach und geht das eine oder andere Mal vielleicht auch schief, wenn man sich mögli-cherweise ein zu leichtes Stück aussucht und dann etwas schlechter bewertet wird. Oder dass man hinterher sagt, das Stück war zu schwer für den Chor, was mir bisher Gott sei Dank noch nie passiert ist.
SINGEN: Mit wie viel Vorlauf beginnen Sie denn, das Wettbewerbsprogramm zu proben?
JT: Im Amateurmusikbereich sind das schon einige Monate bis hin zu einem Jahr.
SINGEN: Und wie hält man über einen so langen Zeitraum die Motivation im Chor aufrecht?
JT: Die meisten Chöre arbeiten ja nicht nur auf einen Wettbewerb hin, sondern haben auch ein alltägliches Programm im Jahresverlauf. Da ist also in der Regel genug Abwechslung dabei. Natürlich gibt es sicherlich Situationen, in denen man sich denkt „Ich möchte das Stück heute einfach nicht sehen oder diese eine Stelle nicht zum 100. Mal proben“ – das kommt vor. Aber in der Regel schaffen es die Chorleiter:innen schon, ihre Sänger:innen mit ein bisschen Abwechslung zu motivieren, sodass man sich mit ein bisschen Abstand auch wieder auf die Stücke fokussieren kann, die für den Wettbewerb gedacht sind.
SINGEN: Das ist vermutlich gerade bei zu leichten Stücken ein Problem…
JT: Genau. Aber auch wenn man ein zu schweres Stück ausgewählt hat, bei dem man als Sänger:in nicht das Gefühl hat, voranzukommen; dass der Berg an Aufgaben viel zu hoch ist und man das Ziel gar nicht sieht, ist das genauso ein Problem. Wenn man gar nicht fertig wird und ewig nicht das Gefühl hat, dass es klingt, weil man zum Beispiel schwierige Harmonien hat, dann kann das sehr zäh werden.
Da muss man einfach eine gute Mischung finden, sodass die Sänger:innen einerseits schnell gewisse Fortschritte sehen, aber trotzdem nicht unterfordert sind, weil das Stück bereits nach drei oder vier Proben perfekt läuft. Die Kunst ist also, einen Mittelweg zu finden – nicht zu schwer und nicht zu einfach. Sonst leidet die Motivation auf jeden Fall.
SINGEN: Wie sieht die Probenarbeit bei Ihnen aus? Womit fangen Sie an?
JT: Ich bin immer ein Freund davon, eine Mischung aus Tutti- und Einzelproben zu machen, damit nicht der gesamte Chor da sitzt und wartet, während eine Stimme eine schwierige Passage probt. In einer Gesamtprobe sollten auch alle gefordert sein. Das Proben einzelner Stellen, die einem in der Vorbereitung auffallen, sollte man tatsächlich auf Einzelproben legen. Da kann man ja gerade diese Stimme eine halbe Stunde früher kommen lassen und das Geprobte dann in der anschließenden Gesamtprobe direkt umsetzen.
Bei schwereren, komplexen Stücken nehme ich das gesamte Stück in Häppchen auseinander, die dann nach und nach wieder zusammengefügt werden – und so setzt man das Stück dann wieder zusammen.
Es hilft sicherlich, wenn man sich am Anfang ein paar Stellen genauer ansieht und sich überlegt, was der Komponist oder die Komponistin hier warum gemacht hat. Ich mache allerdings keine Theorieproben, wo ich zwei Stunden das Stück harmonisch analysiere und interpretiere. Das baue ich einfach zu gegebener Zeit in die Probe ein.
SINGEN: Wie profitieren denn die Sänger:innen von dieser intensiven Probenarbeit bei der Vorbereitung auf einen Wettbewerb?
JT: Im Gegensatz zu einem Konzert mischt sich bei der Vorbereitung auf einen Wettbewerb die Vorfreude mit einer gewissen Aufgeregtheit. Was passiert? Wie kommt der Vortrag bei der Jury an? Wie werden wir bewertet? Im Vergleich zu anderen Auftritten oder Konzerten ist die Jury ja ein kritischeres Publikum. Das sorgt für mehr Aufregung und Spannung, was den Chor aber im positiven Sinne beeinflussen kann. Der Zusammenhalt einer Gruppe wird gestärkt, wenn man auf so ein ganz besonderes Ziel hinarbeitet.
Meine Chöre machen nicht jedes Jahr bei einem Wettbewerb mit, insofern ist das schon etwas Besonderes und eine Abwechslung vom Chor-Alltag. Das tut der Gruppe gut und ich glaube auch musikalisch gesehen kommt man in der Regel bestärkt aus so einem Wettbewerb heraus. Also je nach Jury-Bewertung natürlich.
In allen Chören, mit denen ich bisher auf einem Wettbewerb war, ist das immer wieder ein Gesprächsthema und eine Erinnerung. Da geht es ja nicht nur ums Musikalische, sondern auch um den Festival-Charakter, den ein Wettbewerb in der Regel ebenfalls hat, weil man hier Chöre kennenlernt, die man sonst vielleicht nie erleben würde. Oder weil man bei internationalen Wettbewerben auch mal ganz andere Stilrichtungen hören kann. Mir persönlich ist beispielsweise ein Chor aus Neuseeland in Erinnerung geblieben, der in traditioneller Sprache und traditioneller Kleidung auf der Bühne stand – das war ein für mich ganz ungewöhnlicher Klang, das werde ich nie vergessen!
SINGEN: Wie oft nehmen Sie mit Ihren Chören denn an einem Wettbewerb teil?
JT: Das kann man nicht verallgemeinern, da gibt es keine feste Regel. Und durch die ganze Pandemie hat sich das sowieso alles verschoben. Das ist auch abhängig von der sonstigen Planung eines Chores. Wenn man gerade auf ein großes Konzert hinarbeitet, nimmt man von der parallelen Vorbereitung auf einen Wettbewerb eher Abstand.
Im Schnitt würde ich sagen: alle vier bis fünf Jahre. Letztendlich ist das ja auch eine zeitliche und eine finanzielle Herausforderung. Das wäre jährlich gar nicht umsetzbar.
SINGEN: Wie erleben Sie Ihren Chor unmittelbar nach einem Wettbewerb?
JT: Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die Sänger:innen direkt nach einem Wettbewerb erstmal einen kleinen Durchhänger haben (lacht). Die meisten wollen da erstmal durchatmen. Ich denke, da sind dann die pädagogischen Fähigkeiten der Chorleiter:innen gefragt, die Leine auch mal etwas lockerer zu lassen. Und dann kommt aber auch relativ schnell wieder die Zeit, in der man merkt, dass das im letzten Jahr Gelernte wieder abgerufen wird. Aus meiner Sicht bleibt da schon viel hängen. Ich kann bis auf ganz wenige Ausnahmen sagen, dass der Chor davon eigentlich immer profitiert hat. Da bleibt etwas hängen und das merkt man auch.
SINGEN: Wie geht man denn damit um, wenn die Bewertung nicht ganz so positiv ausgefallen ist, wie man es sich erhofft hat?
JT: Wenn man mit extrem hohen Erwartungen in einen Wettbewerb geht und dann nicht das Ziel erreicht, das man sich selbst gesteckt hat, ist die Frustration natürlich groß. Da muss man als Chorleiter:in im Vorfeld vielleicht auch mal eine reelle Einschätzung wiedergeben. Aber wenn das Ergebnis tatsächlich überraschend deutlich schlechter ist als erwartet – auch das habe ich schon erlebt – ist der Frust natürlich groß. Dann ist es die Aufgabe des Chorleiters oder der Chorleiterin, die eigene Enttäuschung erst einmal hinten anzustellen und den Chor aufzufangen und wieder aufzubauen. Das ist natürlich für niemanden leicht wegzustecken. Oft hört man dann Sätze wie zum Beispiel „Das machen wir nie wieder!“ Diese negative Energie muss man aber umkehren und sagen: „Doch! Genau deshalb machen wir das nochmal. Wir arbeiten an den Dingen, für die wir kritisiert worden sind und machen es dann das nächste Mal einfach besser!“
Musik ist nicht immer ganz einfach zu bewerten. Eine Mathe-Aufgabe ist entweder richtig oder falsch. Aber bei Kunst und Musik gibt es eben Interpretationsspielraum. Klar, falsche Töne sind falsche Töne, Intonation ist entweder sauber oder nicht, aber bei der Interpretation, dem Tempo oder ähnlichem kann man unterschiedlicher Meinung mit der Jury sein.
Ich persönlich finde es wichtig, dass die Jury bei einer enttäuschenden Bewertung eine plausible Erklärung liefert. Denn diese kann auch der oder die Chorleiter:in mitnehmen und den Sänger:innen so weitergeben. Dann bekommt man das auch wieder hin. Aber klar, eine negative Bewertung nagt schon eine gewisse Zeit lang an einem selbst und auch am Chor als Gemeinschaft.
SINGEN: Woran liegt es denn, wenn die Bewertung tatsächlich mal nicht besonders gut ist? Sind das eher interpretatorische Fragen oder kann es auch sein, dass der Chor einfach mal einen schlechten Tag hat?
JT: Es gibt beides! Bei mir war es sogar mal so, dass der Chor ausgerechnet bei dem einen von insgesamt vier Stücken total abgerutscht ist, bei dem ich mir absolut sicher war, dass das super gut läuft. Da ist es im Nachhinein schwer zu sagen, woran es lag. Die Kritik der Jury war berechtigt, das war für mich auch im Gespräch ganz klar. Und mit dieser Kritik konnte ich dann auch ganz gut leben.
Manchmal geht es aber wirklich auch um Interpretation, da hieß es im Gespräch dann, das Stück sei viel zu schnell gewesen, man selbst ist aber vielleicht der Meinung, dass genau dieses Tempo passend ist. Aber das ist eben Kunst. Und die ist – vielleicht auch zum Glück – nicht messbar. Ich denke, man muss mit Kritik leben können, wenn man sich dazu entschließt, zu einem Chorwettbewerb zu gehen. Es gehört einfach dazu, dass man sich hier bewerten lässt, ohne sich direkt auf den Schlips getreten zu fühlen. Aber ich denke, das kann man von den Chorleiter:innen auch erwarten.
SINGEN: Wie war das denn dann bei Ihnen, war dieser Chor danach noch einmal auf einem Wettbewerb?
JT: (lacht) Ja, die waren nochmal auf einem Wettbewerb. Alle Chöre, mit denen ich schon mal auf einem Wettbewerb war, sind danach auch wieder zu einem Wettbewerb gegangen und sind auch weiterhin bereit, das zu tun.
Das durchaus eindrucksvollste Erlebnis mit schlechter Kritik hatte ich auch gar nicht bei einem klassischen Chorwettbewerb, sondern bei einer TV-Show, in der Chöre bewertet wurden. Da waren die Bewertungen einfach medientauglich, aber nicht fachlich. Und das hat einige schon sehr gewurmt. Aber da steht man drüber. Am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder anders aus.
Das sollte jetzt auch nicht falsch rüberkommen: 90 Prozent der Erfahrungen, die man macht, sind positiv. Aber die zehn Prozent, in denen man sich von einer Jury nicht ganz verstanden fühlt, bleiben viel-
leicht auch einfach länger hängen. Aber nicht dauerhaft.
SINGEN: Gibt es Chöre, denen Sie in bestimmten Situationen von der Teilnahme an einem Wettbewerb abraten würden?
JT: Grundsätzlich abraten würde ich nie. Manchmal gibt es vielleicht Konstellationen, die nicht ideal sind. Wenn man beispielsweise 40 Frauen und drei Männer hat, ist es natürlich schwierig, einen vierstimmigen Chorsatz wettbewerbstauglich auf die Bühne zu bringen. Dann muss man erstmal überlegen, welche Möglichkeiten man hat. Das Finale des Deutschen Chorwettbewerbs ist in dem Fall sicherlich kein realistisches Ziel. Eine Möglichkeit wäre aber vielleicht ein regionaler Wettbewerb, für den man projektweise ein paar Männerstimmen dazu holt und eben auf diesem Level versucht, das Beste herauszuholen.
Aber grundsätzlich abraten würde ich nie. Meiner Meinung nach tut das immer gut! Vielleicht muss es ja auch gar nicht die aktive Teilnahme am Wettbewerb sein, oft reicht es ja schon, wenn man mal über seinen Tellerrand hinausblickt und beispielsweise bei einem Festival den anderen Chören zuhört, die vielleicht die gleichen Stücke wie man selbst im Programm haben; oder man macht bei einem Treffen mit anderen Chören mit. Man muss etwas finden, dass der Leistungsfähigkeit des eigenen Chores entspricht, um den Frustfaktor möglicht gering zu halten oder sogar ganz auszuschließen.
SINGEN: Hat die Teilnahme an einem Wettbewerb auch eine Art Werbeeffekt für potenzielle neue Mitglieder?
JT: Man macht natürlich schon irgendwie Werbung, indem man die Ergebnisse eines solchen Wettbewerbs ja beispielsweise auch in der Tageszeitung veröffentlichen möchte. Aber konkret Mitgliederwerbung im Nachhinein… Ich glaube, das ist umgekehrt häufiger der Fall, also dass man mit dem Ziel Chorwettbewerb Werbung macht und dafür noch Sänger:innen sucht, die dann im Nachheinein auch häufig hängen bleiben.
SINGEN: Was war denn für Sie das schönste oder berührendste Erlebnis auf einem Wettbewerb mit einem Chor?
JT: Das sind so viele… Ich kann mich an zahlreiche Situationen erinnern, in denen ein Chor vor dem Wettbewerb wahnsinnig aufgeregt war. Und der Moment, wenn man dann von der Bühne herunterkommt, alles geklappt hat und man total glücklich ist und sich in den Armen liegt – das ist jedes Mal sehr bewegend. Der Moment nach dem Auftritt, wenn die Last abfällt. Das könnte ich auch gar nicht auf einen Wettbewerb beschränken.
Bei internationalen Wettbewerben, wo Chöre von ganz unterschiedlichen Konti-
nenten zusammenkommen, finde ich es immer unglaublich beeindruckend zu sehen, wie vielfältig Chormusik weltweit eigentlich ist. Ich bin immer wieder aufs Neue begeistert, was man da sehen und erleben kann oder was da für Stücke aufgeführt werden, von denen ich noch nie zuvor etwas gehört hatte. Diese Auftritte sauge ich regelrecht auf. Die internationalen Begegnungen – auch die Treffen mit Chorleiter:innen aus der ganzen Welt – sind für mich persönlich ein großes Plus. Manchmal bleiben diese Kontakte auch über Jahre bestehen, das finde ich wirklich schön. Nicht nur der eigentliche Wettbewerb und der eigene Auftritt, sondern auch das ganze Drumherum – also die anderen Chöre, die Atmosphäre – ist für mich unheimlich wertvoll.
SINGEN: Herr Thum, vielen herzlichen Dank für dieses informative Gespräch und weiterhin alles Gute für Ihre Wettbewerbsvorbereitungen!
- geboren 1975
- Musikpädagogik-Studium mit Schwerpunkt Chor- und Orchesterleitung
- hauptberuflicher Chorleiter von elf Chören
- Dirigent seit über 30 Jahren
- Dozent für Musikpädagogik, Musiktheorie und Gehörbildung in Baden-Württemberg
- Mitglied der Jury beim Bundeswettbewerb Jugend Musiziert, Deutscher Musikrat
Weitere Informationen: www.joerg-thum.de