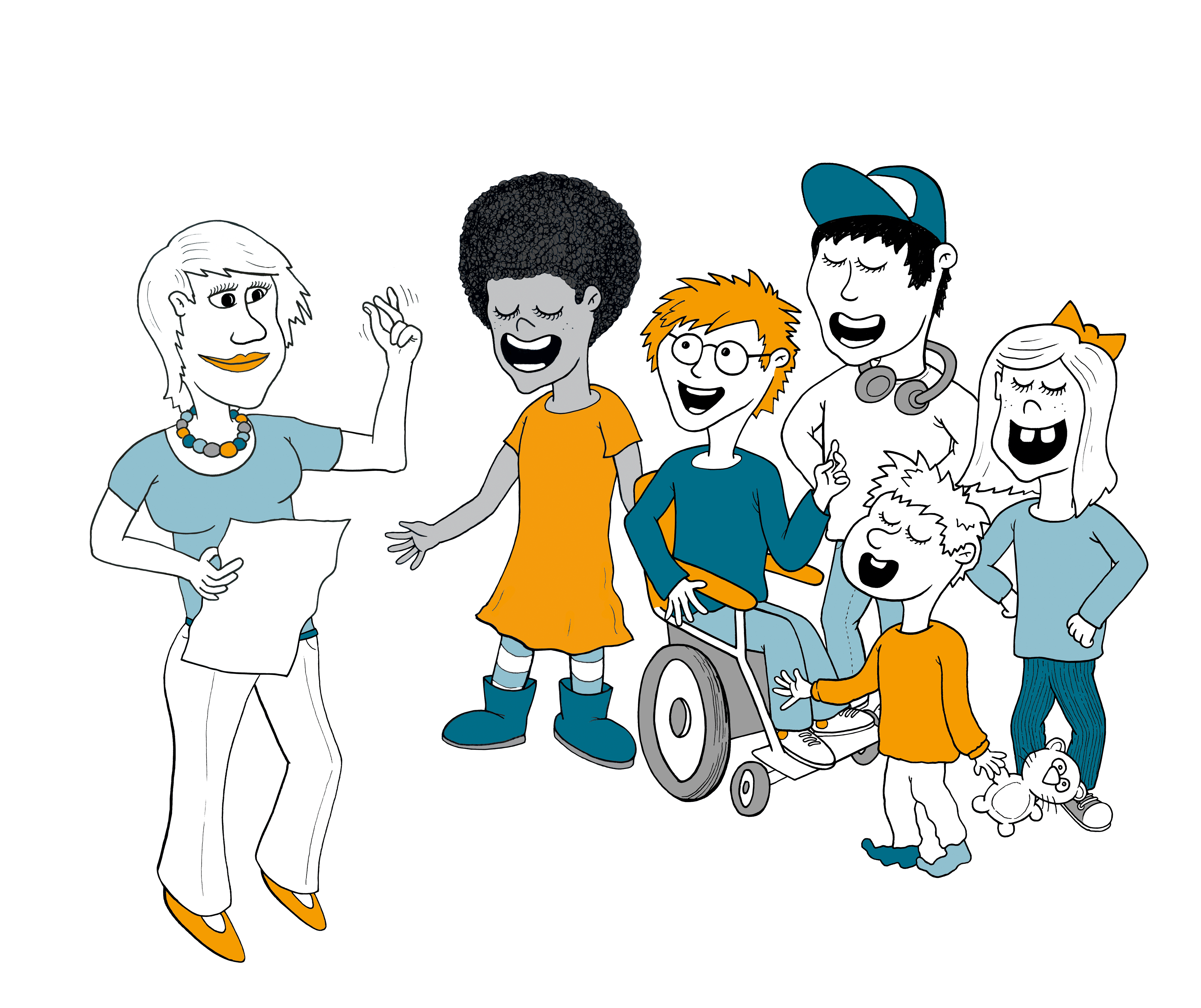Die Deutsche Chorjugend gibt Tipps zum Aufbauen von Kooperationen zwischen Chorvereinen und Schulen
Für den Aufbau einer Kooperation zwischen einem Chorverein und einer Schule haben sich die folgenden Schritte als sinnvoll erwiesen. Die Deutsche Chorjugend e.V. (DCJ) hat in zwei Projekten Erfahrungen darin gesammelt, Chorangebote im Ganztag aufzubauen. Die Schritte sollen als Leitfaden dienen, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie der Ablauf der Kooperation aussehen kann – besonders, wenn der Verein noch keine Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit dem Ganztag einer Schule hat. Der Prozess wird aus Perspektive eines Chorvereins dargestellt. Er kann angepasst werden auf eine Schule, die eine Kooperation mit einem Chorverein eingehen möchte.
Die Erfahrung der Deutschen Chorjugend zeigt, dass bei der Zusammenarbeit zwischen außerschulischen Chören und Schulen häufig folgende Personen relevant sind: die Schulleitung, die Koordinator:innen des Ganztags und die Musiklehrkräfte. Gerade die Musiklehrkräfte haben sich in der Praxis oft als „Türöffner“ erwiesen: Sie wissen um die Wichtigkeit von Singen und Musik und können die Schulleitung überzeugen, dass eine Chor-AG im Ganztagsangebot eine gute Sache ist. Hilfreich ist es auch, wenn die Ganztagsbeauftragten oder die Schulleitung selbst einen Zugang zu (Chor-)Musik oder Chorsingen haben. Dies ist natürlich Glückssache.
Die Träger des Ganztags (z. B. Wohlfahrtsverbände oder Träger der freien Jugendhilfe) kommen eher selten direkt ins Spiel, da die Schulleitung grundsätzlich über das Zustandekommen einer Kooperation im Ganztag entscheidet.
Schritt 1
Die Personen im Chorverein entscheiden sich, an welcher Schule sie gern aktiv werden möchten. Dabei sollten folgende Kriterien eine Rolle spielen: Die Schule sollte sich in der Nähe des Chorprobenortes des Vereins befinden, um den Kindern später den Einstieg zum Chor möglichst leicht zu machen. Der Verein darf die Kooperationseffekte für seine Nachwuchsförderung nutzen! Wenn bereits ein Schulchor an einer Schule existiert, empfehlen wir, nicht in Konkurrenz zu gehen, sondern sich den Schulen zuzuwenden, in denen es noch keine Chor-Angebote gibt. Gymnasien sind häufig im Vergleich zu anderen Schulformen sehr gut mit musikalischen Angeboten ausgestattet. Wir empfehlen, eine andere Schulform für die Kooperation auszuwählen. Hat eine Schule engagierte Musiklehrer:innen, die Chor-
Angebote wichtig finden, aber selbst keine Ressourcen haben, diese anzubieten, sind die Chancen für ein Zustandekommen einer Kooperation am höchsten.
Schritt 2
Personen aus dem Chorverein suchen eine Chorleitung, die eine Chor-AG-Leitung übernehmen kann. Dabei geht es um zeitliche Kapazitäten der Chorleitung, eventuell notwendige Fortbildungen und finanzielle Kapazitäten des Chorvereins bzw. der kooperierenden Schule. Das ist der Dreh- und Angelpunkt einer jeden Kooperation: Bringen die Chorvereine keine Sing-Anleitungskompetenzen mit, kann die Kooperation meistens nicht stattfinden.
Schritt 3
Personen aus dem Chorverein können auch Finanzierungsmöglichkeiten suchen. Das erhöht die Chancen einer Kooperation enorm. Sobald die Finanzierung zumindest für die Chorleitungsstunden gesichert ist, kann die Kooperation starten. Eine Übersicht über mögliche Finanzierungsquellen findet sich in der Broschüre der DCJ „Damit mehr Kinder singen dürfen! Chorangebote an Schulen gestalten“.
Schritt 4
Jetzt ist der Zeitpunkt für einen guten Projekttitel. Dieser muss vor allem Kinder bzw. Jugendliche ansprechen. Erfahrungsgemäß kommen traditionelle Titel wie „Chor-AG“ bei jungen Menschen nicht an, die vorher keine Berührungspunkte mit Chormusik hatten. Aus unseren Projekten gibt es folgende Beispiele für Titel für das Chorangebot an der Schule: Vocal Play-ground, Soul-Keepers, [Schulname]-Vocals, [Ortsname]-Vocals etc. Fehlen hier die guten Ideen, hilft ChatGPT auch in der kostenlosen Version.
Schritt 5
Die Personen aus dem Chorverein nehmen Erstkontakt zu der Schule auf – entweder durch „warme“ Kontakte (man kennt also schon eine Person von der Schule) oder durch „Kaltakquise“. Wahrscheinlich werden sowohl eine E-Mail als auch ein Telefonat nötig sein. Wenn niemand aus dem Verein die relevanten Personen an der Schule wie Musiklehrkräfte, Ganztagskoordinator:innen oder Schulleitungen kennt, sollte Zeit eingeplant werden, um die Kontaktdaten der relevanten Ansprechperson herauszufinden.
Schritt 6
Bei einer Kaltakquise muss man sich häufig vom Schulsekretariat zu den entsprechenden Personen durchtelefonieren, denn oftmals sind die Kontaktdaten beispielsweise der Ganztagskoordinator:innen nicht auf der Schulwebsite vermerkt. Die DCJ hat die Erfahrung gemacht, dass die Ganztagskoordinator:innen die Kooperationen häufig ermöglicht haben, wenn sie selbst vom Chorsingen überzeugt waren und von uns überzeugt wurden, wie wichtig ein Chorangebot für die Schule ist.
Schritt 7
Auf ein erstes Telefonat mit der Schulleitung oder einer anderen „türöffnenden“ Person (z. B. Musiklehrer:in) folgt idealerweise ein Gespräch zwischen Schulleitung bzw. der zuständigen Person der Schule, Person aus dem Chorverein und der Chorleitung. Die Schulleitung möchte verständlicherweise wissen, was für eine neue Person an die Schule im Nachmittagsbereich kommt.
Schritt 8
Entscheiden sich alle drei Seiten – Chorverein, Schule, Chorleitende Person – für eine Kooperation, ist eine schriftliche Kooperationsvereinbarung vonnöten. Auch ein Honorarvertrag für Chorleitende und eine Aufwandsentschädigung für Chor-Organisierende sind wichtig. Ein erweitertes Führungszeugnis der Chorleitung oder anderer Vereinspersonen, die das Chorangebot an der Schule begleiten, ist selbstverständlich Pflicht. Ergänzend dazu kann eine Selbstverpflichtungserklärung unterschrieben werden, in dem es darum geht, dass sich die Beteiligten dazu verpflichten, mit den ihnen anvertrauten Kindern bzw. Jugendlichen gut umzugehen. Außerdem wird ein Masernschutz der Chorleitung oder anderer Vereinspersonen, die das wöchentliche Angebot in der Schule begleiten, Pflicht sein.
Schritt 9
Bewährt hat es sich, Schnupperangebote zu machen: Die Chorleitung geht durch die Klassen, stellt sich vor, macht einige einfache Singübungen mit den Schüler:innen. So bekommen diese einen Vorgeschmack darauf, was sie im Chor im Ganztag erwartet und wer die Person ist, die dies anbietet. Mit den unterstützenden Personen aus der Schule besprecht ihr weitere Möglichkeiten, das Chor-Angebot bei den Kindern bzw. Jugendlichen in der Schule bekannt zu machen, z. B. Plakate im Eingangsbereich oder in der Mensa.
Schritt 10
Das Chorangebot wird an der Schule bekannt gemacht. Die Schüler:innen melden sich an.
Schritt 11
Die erste Chor-AG findet statt. Nach der ersten Chor-AG ist ein Gespräch zwischen der Chorleitung und der Person aus dem Verein, die die Kooperation aufbaut, ratsam: Wie lief die AG? Was sollte geändert werden? Was ist noch notwendig?
Schritt 12
Die Chor-AG etabliert sich – idealerweise. Vielleicht findet nach ein paar Monaten bereits der erste Auftritt statt, zum Beispiel beim Schulfest oder bei der Schulweihnachtsfeier. Auch wenn die Zwischenergebnisse nicht perfekt sind, ist es wichtig, im Schulalltag präsent zu sein.
Arbeitshilfe der Deutschen Chorjugend
„Damit mehr Kinder singen dürfen! Chorangebote an Schulen gestalten“
Ob Chorleitende und Chororganisierende von Kinder- und Jugendchören, Vorstände von Chorvereinen und Chorjugendverbänden, erfahrene und junge Sänger:innen und weitere Engagierte in der chormusikalischen Kinder- und Jugendarbeit: Die Arbeitshilfe richtet sich an alle, die im Bereich Schulkooperationen tätig sein möchten oder es schon sind.
Das PDF kann kostenlos heruntergeladen werden. Die Broschüre ist hier in Druckform bestellbar.