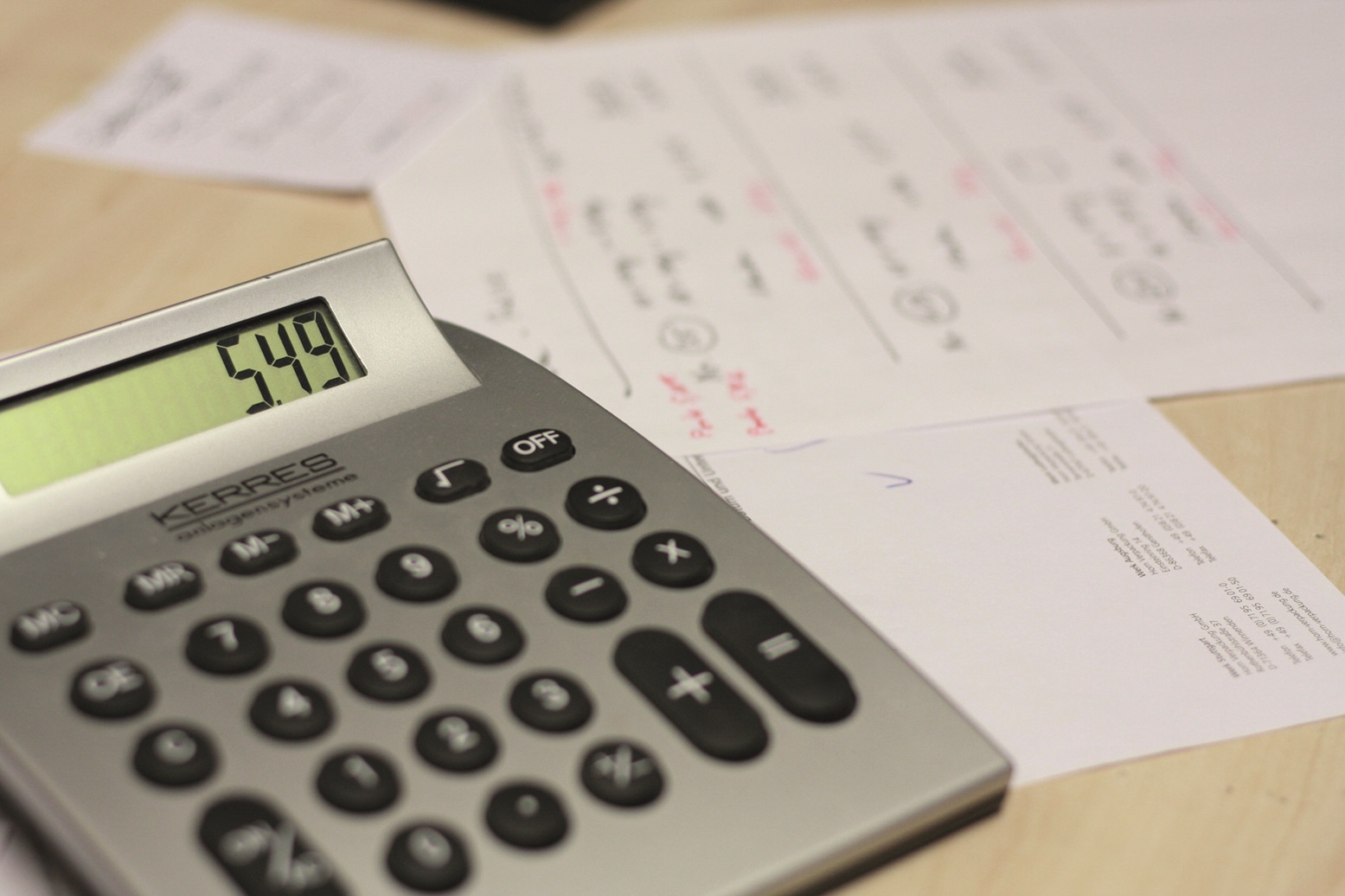Warum Fördermittel kein Hexenwerk, sondern eine gute Ergänzung im Vereinshaushalt sind
Ein steter finanzieller Strom, der jeden Monat verlässlich auf dem Vereinskonto landet und durch den die regelmäßig anfallenden Kosten zuverlässig gedeckt werden können, das wünschen wir uns alle für unsere Chor- und Vereinskassen. Dies können Mitgliedsbeiträge sein, regelmäßige Spenden (am liebsten im Dauerauftrag) oder regelmäßige öffentliche Fördergelder wie z. B. die jährliche Pauschale des Landes Baden-Württemberg für Ensembleleiter:innen. Im Zusammenhang mit Fördergeldern sprechen wir hier von institutioneller Förderung. Diese hat einen eher allgemeinen Verwendungszweck – die Unterstützung der Einrichtung als solche.
Im Alltag eines Förderprogramms aus Bundesmitteln wird immer wieder deutlich, dass dies ein Umdenken erfordert, insbesondere wenn man zum ersten Mal einen Antrag auf Projektförderung stellt. Wenn Ihr Euch darauf einlasst und ein paar Grundregeln beachtet, erschließt Ihr Euch dadurch eine lukrative zusätzliche Einnahmequelle.
Der Projektzeitraum oder: Alles hat ein Ende …
Jedes Förderprojekt braucht einen festen Anfang und ein festes Ende. Das klingt zunächst selbstverständlich, dieser Projektzeitraum muss aber im Antrag festgelegt werden und darf im Allgemeinen erst nach der Bewilligung beginnen. Dies hat zwei konkrete Folgen: Alle Ausgaben, Rechnungen oder Verträge müssen innerhalb dieses Zeitraums liegen und alle laufenden Kosten können nicht aus Projektgeldern bezahlt werden.
Das bedeutet nicht, dass die Miete für den Probenraum oder das Honorar der Chorleitung grundsätzlich von der Förderung ausgeschlossen sind. Alle Honorar- oder Mietverträge müssen aber eigens für den Projektzeitraum geschlossen werden und notwendiger Bestandteil des Projekts sein.
Die Projektidee oder: „Wir wollen doch einfach nur proben & Konzerte geben …“
Ein Förderprojekt muss nicht nur einen festen Projektzeitraum, sondern auch eine eigene Projektidee haben, die je nach Förderprogramm z. B. eine Auswahlkommission überzeugen muss. Dies ist die zentrale Aufgabe und deshalb auch die größte Herausforderung eines Förderantrags. Im Gespräch mit Antragstellenden fallen häufig Sätze wie „Wir wollen einfach wie immer proben.“, „Wir machen jedes Jahr zwei Jahreskonzerte.“ oder „Wir haben immer unser großes Sommerkonzert.“ Verbunden mit Frage: „Wie soll ich daraus ein Projekt machen?“.
Als Hilfestellung kann Euch dienen, das vermeintlich Selbstverständliche möglichst konkret aufzuschreiben: Das Sommerfest oder das Adventskonzert haben in aller Regel einen Konzerttitel, der als vorläufiger Projekttitel herhalten kann. Als Projektbeschreibung notiert Ihr, was alles für diese Konzert notwendig ist: die musikalischen Bestandteile wie Chorleitung, Chorproben oder Konzertprogramm und die organisatorischen Bestandteile wie Probenraum, Konzertort oder ehrenamtliche Helfer:innen. Auf diese Weise lässt sich jedes Konzert, jede Veranstaltung, jedes Vereinsfest als Projekt beschreiben, ohne dass Ihr Euch dafür etwas aus den Fingern saugen müsst.
Ausgehend von diesem „Standardprojekt“ könnt Ihr Euch überlegen, was Ihr beim Projekt, das Ihr beantragt, hinzufügen oder verändern möchtet.
Die Fördersumme oder: „Was koscht‘s?“
Ein wichtiger Bestandteil des Förderantrags ist der Finanzplan. Niemand erwartet von Euch, dass bei der Antragstellung, also bevor das Projekt überhaupt beginnen darf, alle Ausgaben bis auf Heller und Pfennig bzw. den letzten Cent feststehen. Ähnlich wie bei der Projektidee kann Euch auch hier eine Veranstaltung aus der Vergangenheit als Grundlage dienen. Berücksichtigt für eine realistische Kalkulation alle Kosten, die von der ersten Probe bis zur Buchung des letzten Belegs anfallen.
Auch wenn vor der Bewilligung des Antrags noch keine Verträge geschlossen werden dürfen, könnt Ihr Euch schon mal umhören und -schauen: Welche Miete würde für den Konzertort anfallen? Was würden Solist:innen für einen Auftritt verlangen? In welcher Größenordnung bewegen sich Kosten für Licht- oder Tontechnik?
Um abzuschätzen, ob eine Ausgabe gefördert wird, könnt Ihr Euch bei allen anfallenden Kosten die Frage stellen: Ist die Ausgabe für das Gelingen des Projekts unbedingt notwendig?
Der Mix macht’s!
Es müssen nicht alle organisatorischen Tätigkeiten ehrenamtlich erfolgen. Ausgaben für eine bezahlte Projektleitung, die während des Projektzeitraums alle organisatorischen Fäden in Händen hält oder für eine Buchhaltung, die sich um das Sammeln aller Belege und die Abrechnung des Projekts kümmert, können im Projektantrag berücksichtigt und gefördert werden. In der Regel ist bei Förderprogrammen ein finanzieller Eigenanteil erforderlich, der prozentual zu den Gesamtkosten berechnet wird. Hier ist ein Blick in die Ausschreibung eines Förderprogramms unerlässlich. Dort finden sich alle formalen Voraussetzungen für die Antragstellung und Regeln des Förderprogramms. Die Finanzierung des Eigenanteils sollte von Beginn an mitgedacht werden. Dieser muss nicht aus dem Vereinsvermögen bestritten werden, sondern kann z. B. durch Konzerteinnahmen gedeckt werden. Es ist aber sinnvoll, das finanzielle Risiko an dieser Stelle zu verringern und mehrere Geldquellen in Erwägung zu ziehen.
Bei den Förderprogrammen für die Amateurmusik im Rahmen von „Neustart Kultur“, die beim Bundesmusikverband Chor & Orchester angesiedelt sind, beträgt der Eigenanteil zehn Prozent. Eine Besonderheit liegt darin, dass dieser Anteil komplett in Form von ehrenamtlicher Eigenleistung erbracht werden kann. Denn der Erfolg von vielen Projekten im Bereich der Amateurmusik wäre ohne ehrenamtliches Engagement von vielen Vereinsmitgliedern und Helfer:innen aus dem Umfeld gar nicht denkbar!
Anzeige